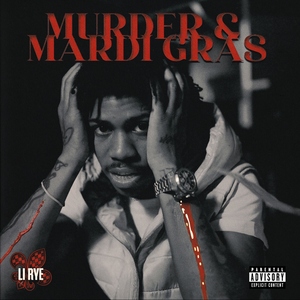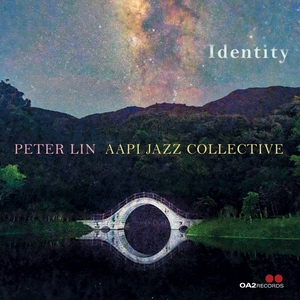Übersicht über die Albumrezensionen: Li Rye, Dave Stewart und mehr
Jede Woche treffen Dutzende neuer Alben in der Redaktion von Maxazine ein. Viel zu viele, um sie alle anzuhören, geschweige denn zu rezensieren. Eine Rezension jeden Tag bedeutet, dass zu viele Alben zurückbleiben. Und das ist eine Schande. Deshalb veröffentlichen wir heute eine Übersicht der Alben, die in Kurzrezensionen in der Redaktion eintreffen.
The Swell Season – Forward
The Swell Season ist ein Folk-Duo bestehend aus dem Iren Glen Hansard und der Tschechin Markéta Irglová. Die Idee hinter dem Bandnamen stammt buchstäblich aus Hansards Lieblingsbuch, das 1975 von Josef Škvorecký geschrieben wurde. Die meisten kennen Hansard jedoch von seiner Band The Frames. Sie erlangten mit The Swell Season Bekanntheit durch den Film Once, der im Wesentlichen ihre Geschichte erzählte und in dem sie selbst die Hauptrollen spielten. Es ist bereits über 15 Jahre her, dass wir ein Album des Duos gesehen haben, aber sie scheinen sich wiedergefunden zu haben. Das hört man auch auf dem Album, obwohl die Songtitel bereits viel verraten. Songs beginnen reduziert, bevor orchestrale Elemente und Chöre hinzukommen, was charakteristisch für ihren Sound ist und den Songs Kraft verleiht. Es dauerte eine Weile, aber die Klasse ist immer noch hörbar. (Rik Moors) (7/10) (Masterkey)
Dave Stewart – Dave Does Dylan
Der Eurythmics-Mitbegründer Dave Stewart präsentiert mit “Dave Does Dylan” eine intime Hommage an seine vierzigjährige Freundschaft mit Bob Dylan. Diese vierzehn Dylan-Cover entstanden spontan – aufgenommen mit dem iPhone während Studienschichten und Hotelaufenthalten, was der Authentizität zugutekommt. Das minimalistische Konzept funktioniert wunderbar: nur Gitarre und Gesang, alles in einem Take aufgenommen. Klassiker wie “Lay, Lady, Lay” und “Knockin’ On Heaven’s Door” erhalten neue Intimität, während tiefere Schnitte wie “To Ramona” Stewarts Liebe zu Dylans Katalog zeigen. Der emotionale Höhepunkt ist “Emotionally Yours,” für das Stewart einst das Musikvideo drehte. Die rohe Produktion unterstreicht die persönliche Verbindung, aber Stewarts Stimme fehlt manchmal die notwendige Rauheit für Dylans komplexe Texte. Das Album fühlt sich mehr wie ein Tagebuch an als eine künstlerische Neuinterpretation. Für Dylan-Puristen eine charmante Kuriosität; für Stewart-Fans ein seltener Einblick in seine musikalische DNA. Wie “Sweet Dreams (Are Made of This)” zeigt dies die Kraft nüchterner Authentizität. Eine Hommage an Dylan, gewiss. Auch schön, dass man heutzutage offenbar solche Aufnahmen mit einem iPhone machen kann. Nervig? Auch. Nicht sehr interessant. (Jan Vranken) (6/10) (Surfdog Records)
Raquel Marina – Kind Words
“Kind Words” ist das erste vollständige Album dieser kanadischen Sängerin, die eine angenehm hörbare Mischung aus Jazz und Folk bringt. Erwähnenswert ist auch: Marina hat keinen einzigen Cover aufgenommen, alle Songs sind original. Echte Lieder, jedes mit einer Geschichte auf einer schönen, ansteckenden Melodie und wunderschönen Arrangements, wovon die Eröffnung “All of It” sofort eine Kostprobe ist, als Marina im Duett mit Kae Murphys Trompete geht. Marina gibt den sie umgebenden Musikern sowieso viel Raum: Hören Sie zum Beispiel “May You Know” mit dem virtuosen Gitarrenspiel von Julien Bradley-Combs. Es muss gesagt werden, dass die Soli diese Platte auf ein höheres Niveau heben, denn trotz eines eigenen Stimmklangs scheint es manchmal, als ob Marina nicht ganz sauber singt. Manchmal schrammt sie daran vorbei… es klingt sehr fragil, unsicher und manchmal neigt es zu einfach falsch, wie in “My Bohemian Hour,” wo sie von Alyssa Giammaria unterstützt wird, die die Gesangsführung zur Hälfte übernimmt. Eine Erleichterung. Der abschließende Track “The Way You Look At Me” macht glücklicherweise viel wett: In etwa neun Minuten zeigt Marina hier – einschließlich Scat – dass sie eine Bereicherung für Easy Listening Jazz ist. Na gut, schließen wir doch mit ein paar freundlichen Worten ab. (Jeroen Mulder) (7/10) (Raquel Marina Music)
Li Rye – Murder & Mardi Gras
Li Ryes “Murder & Mardi Gras” zeigt die harte Realität eines Künstlers, dessen Ambitionen seine technischen Fähigkeiten übersteigen. Das Album beginnt enttäuschend mit “School,” wo der obligatorische absteigende Akkord sofort die musikalischen Begrenzungen bloßlegt, eine verpasste Chance für ein kraftvolles Statement. Die produktionstechnischen Versuche, Li Ryes Mängel zu verschleiern, werden schmerzhaft deutlich auf Tracks wie “Tell Me The Truth.” Trotz glänzender Beats und zusätzlicher Schichten kann die oberflächliche Produktion sein begrenztes melodisches Gefühl und schwaches Timing nicht verbergen. Seine durchlebten Geschichten über Mobile, Alabama verdienen eine bessere musikalische Umrahmung. Wo Li Rye punktet, ist in seinem authentischen Storytelling; die emotionale Ladung seiner Texte trifft wirklich. Jedoch kompensieren gute Absichten nicht die fundamentalen musikalischen Mängel, die das Album plagen. Die Sequenzierung wirkt willkürlich, Akkordschemen bleiben vorhersagbar basic. Für Gucci Manes The New 1017 Label ein riskantes Projekt, das mehr Zeit und Anleitung verdient hätte. Wie viele Young Dolph-Imitatoren fehlt Li Rye die natürliche Musikalität, die Southern Rap wirklich zum Swingen bringt. (Elodie Renard) (5/10) (26K)
AAPI Jazz Collective – Identity
Einen besseren Titel hätte diese Gruppe für ihr Debüt nicht wählen können. Was die Identität angeht, lässt sich das Asian American and Pacific Islander (AAPI) Jazz Collective nicht in eine Schublade stecken. Dreh- und Angelpunkt der Gruppe ist Posaunist Peter Lin, ein Amerikaner mit taiwanesischen Wurzeln. Es wird daher keine Überraschung sein, dass die Musik von AAPI buchstäblich kontinentübergreifend ist: Wir hören amerikanischen Jazz und Fusion mit asiatischen Einflüssen. Das Ergebnis ist eine ansteckende Mischung mit elf originellen und zudem sehr abwechslungsreichen Kompositionen; vom funkigen “Anh Dau Em Do” (Vietnamesisch für “Ich bin dein Mann”) bis zum polierten “A Town With An Ocean View,” das hauptsächlich von dem delikaten Spiel des Trompeters Brandon Choi über das subtile Bürstenwerk des Schlagzeugers Wen-Tin Wu getragen wird. Der Höhepunkt ist jedoch der Bop von “Magpie’s New Years Day.” Und dann haben wir noch “Ringo Oiwake”: ein Titel, der sich auf einen japanischen, folkloristischen Musikstil bezieht, aber wir hören eine unverfälschte, träge Rumba, die uns sofort in lateinamerikanische Sphären bringt. Dennoch bleibt keines der Stücke wirklich “hängen.” Nirgendwo werden wir überrascht, obwohl dies sicherlich kein schlechtes Album ist. Aber wir hören elf separate Stücke ohne verbindenden Faktor. Vielleicht ist es gerade das Fehlen einer klaren Identität, wodurch das Ganze zu sehr wie loser Sand klingt. (Jeroen Mulder) (7/10) (OA2 Records)