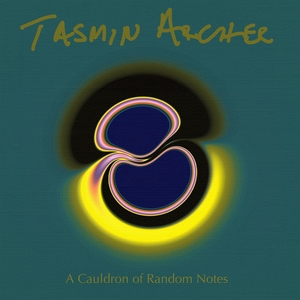Übersicht über die Albumrezensionen: Ice Cube, Tasmin Archer und mehr
Jede Woche treffen Dutzende neuer Alben in der Redaktion von Maxazine ein. Viel zu viele, um sie alle anzuhören, geschweige denn zu rezensieren. Eine Rezension jeden Tag bedeutet, dass zu viele Alben zurückbleiben. Und das ist eine Schande. Deshalb veröffentlichen wir heute eine Übersicht der Alben, die in Kurzrezensionen in der Redaktion eintreffen.
Ice Cube – Man Up
Nach einem Jahr zunehmender gesellschaftlicher Spannungen kehrt Ice Cube mit seinem zwölften Studioalbum zurück, einer direkten Fortsetzung von 2024s “Man Down”. “Man Up” fordert ausdrücklich Verantwortung, sowohl individuell als auch kollektiv. Der Veteran-Rapper beweist, dass seine Stimme nach vier Jahrzehnten noch immer relevant ist. Mit nur einem Gastbeitrag von Scarface hält Cube den Fokus scharf auf seine Botschaft. Stücke wie “Before Hip Hop” kontern den Mythos, dass Rap Gewalt erzeugt, während “California Dreamin'”, aufgebaut auf Patrice Rushens Klassiker “Forget Me Nots”, den amerikanischen Traum durchsticht, wie es einst “It Was A Good Day” tat. Die Produktion bleibt seinen frühen 90er-Wurzeln treu, was nostalgisch anmutet, aber gleichzeitig die zeitgenössische Relevanz untergräbt. Cubes unverblümte Männlichkeit und politische Stellungnahmen werden einige bezaubern und andere abstossen. Es ist rau, ungeschliffen und weigert sich, Zugeständnisse an moderne Trends zu machen. (Elodie Renard) (7/10) (Lench Mob Records/Hitmaker)
Tasmin Archer – A Cauldron of Random Notes
Mehr als dreissig Jahre nach “Sleeping Satellite” beweist Tasmin Archer, dass künstlerische Reife Früchte trägt. Auf ihrem vierten Studioalbum zeigt die nun 62-jährige Sängerin eine musikalische Vision, die erst jetzt vollständig zur Blüte kommt. Der Eröffnungstrack “Vibration of Life” vermischt dubby Gospel mit überraschenden Akkordwechseln, während der Rest des Sets ihre Liebe für abwechslungsreiche Arrangements und sorgfältige Pacing betont. Nach der Intimität früherer Werke klingt dieses Album, als hätte Archer endlich die Puzzlestücke ihrer künstlerischen Identität zusammengefügt. Die Tracy Chapman- und Seal-Vergleiche aus den Neunzigern waren nicht falsch, aber unvollständig – das Album enthält auch unterscheidende Elemente aus den Siebzigern und Achtzigern, die eigentlich nicht zusammenpassen sollten, es aber tun. Stücke wie “Silent Witness” und “Free Fall” zeigen ihre Fähigkeit in emotionaler Authentizität, ohne jemals forciert zu wirken. (Jan Vranken) (6/10) (Parlophone)
Baxter Dury – Allbarone
Nach einem Treffen mit Produzent Paul Epworth auf Glastonbury entstand dieses Meisterwerk – Durys kohärentestes Abenteuer seit “Prince of Tears”. Das neunte Studioalbum transformiert seinen charakteristischen Cockney-Zynismus auf die Tanzfläche, ohne seine scharfen Beobachtungen preiszugeben. Mit beeindruckenden Kritikwerten und zahlreichen Fünf-Sterne-Rezensionen übertrifft “Allbarone” alle Erwartungen. Der Titeltrack “Allbarone”, benannt nach der bekannten Weinbar-Kette, zeigt sofort Epworths Einfluss: Durys Deadpan-Delivery wird plötzlich in einem Club positioniert, wie jemand, der existenziell auf einer überfüllten Tanzfläche wird. Höhepunkte wie “Mockingjay” (inspiriert von “The Hunger Games”) und “Schadenfreude” beweisen, dass erhöhtes Tempo und Introspektion perfekt zusammenpassen. Es ist nicht oft, dass ein Künstler sein bestes Werk bei seinem achten Album schafft, aber bei Dury stimmt dies vollkommen. Eine Renaissance der späten Karriere, die die Latte wieder höher legt, vergleichbar damit, wie “Sleeping Satellite” es einst für Tasmin Archer tat. (Jan Vranken) (8/10) (Heavenly Recordings)
Rachel Chinouriri – Little House (EP)
Im Gegensatz zu den dunklen Themen ihres gepriesenen Debütalbums “What a Devastating Turn of Events” strahlt diese Vier-Track-EP pure Freude über neue Liebe aus. Nach einem Jahr mit BRIT-Nominierungen und ausverkauften Shows zeigt Chinouriri ihre Vielseitigkeit. Singles wie “Can We Talk About Isaac?”, eine Ode an ihren neuen Partner, sprudelt vor prickelnder Energie und sonnigen Indie-Pop-Anthems, in denen Chinouriri mühelos zu excellieren scheint. Die Produktion von Apob, ergänzt durch Chloe Kraemer, verleiht jedem Track einen eigenen Charakter, ohne die Kohäsion zu verlieren. Obwohl “Judas (Demo)” den Ton ändert und den Tod erwähnt, funktioniert dies eher als Erinnerung an die starken Fundamente, auf denen “Little House” gebaut ist. Mit dreizehn Minuten Spielzeit funktioniert die EP perfekt als Appetithäppchen zwischen Alben, während sie Chinoururis künstlerisches Wachstum konsolidiert. Genau wie “So My Darling” einst ihren Durchbruch markierte, beweist diese EP, dass Glück genauso inspirierend sein kann wie Trauma. (Elodie Renard) (7/10) (Parlophone)
Eunike Tanzil – The First of Everything
Mit “The First of Everything” präsentiert die indonesische Komponistin-Pianistin Eunike Tanzil ein bemerkenswert reifes Debütalbum, das den Hörer entlang zwölf musikalischer Momentaufnahmen lebensbestimmender “erster Male” mitnimmt. Als erste weibliche asiatische Komponistin beim prestigeträchtigen Label Deutsche Grammophon trägt Tanzil eine schwere Verantwortung, schafft es aber, diese mit Bravour wahrzumachen. Das Deutsche Symphonie Orchester Berlin unter der Leitung von Anna Handler erweckt Tanzils orchestrale Vision in den akustisch perfekten Teldex Studios zum Leben. Die Vielfalt springt direkt ins Auge: von minimalistischen Klavierpassagen bis hin zu schwelgenden cinematischen Orchestermomenten. Den Höhepunkt bildet zweifellos “Genesis”, eine meisterhafte Hommage an John Williams, in der Tanzil ihre Liebe zur filmischen Orchestersprache zeigt – man hört echte Verwandtschaft mit dem “Imperial March” aus Star Wars im dramatischen Aufbau. Tanzil beweist ihre Vielseitigkeit, indem sie neben Klavier auch Celesta, Glockenspiel und sogar Snaredrum spielt. Die Zusammenarbeit mit Cellistin Sophie Kauer bei “Aria” und “Metamorphosis” bringt eine warme, menschliche Dimension. Besonders ergreifend ist “Remembering”, eine zehn Jahre lang gehegte Melodie für ihre verstorbene Grossmutter, die den emotionalen Kern des Albums bildet. Kritikpunkte gibt es kaum bei diesem polierten Debüt, obwohl einige Übergänge zwischen Stücken etwas abrupter wirken. Das träumerische “Reverie”, inspiriert von Ravel, zeigt Tanzils respektvollen Umgang mit klassischer Tradition, während sie eine eigene Stimme entwickelt. Das Album beweist, dass Orchestermusik quicklebendig ist und neue Geschichten für eine moderne Generation erzählen kann. Ein schönes klassisches Album für Menschen, die nicht gewohnt sind, klassische Musik zu hören. (Jan Vranken) (8/10) (Deutsche Grammophon)